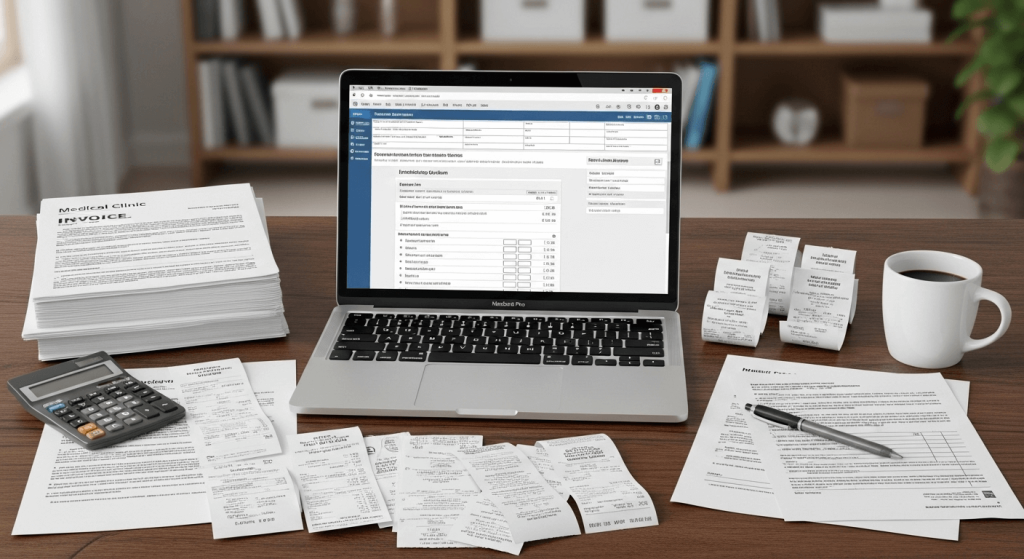Die Frage, wie man Pflegekosten praktisch und korrekt in die jährliche Steuererklärung einträgt, beschäftigt jedes Jahr zahlreiche Menschen in Deutschland. Gerade im Kontext einer alternden Gesellschaft nimmt das Thema Pflege einen immer zentraleren Platz in der Lebensrealität vieler Bürgerinnen und Bürger ein. Angehörige, die täglich Pflege leisten oder eine organisierte Betreuung für ihre Eltern, Großeltern oder Partner organisieren, sehen sich nicht nur mit emotionalen und gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert, sondern auch mit finanziellen Belastungen. Diese zu erkennen, richtig einzuordnen und steuerlich geltend zu machen, kann helfen, die Last zumindest auf wirtschaftlicher Ebene zu verringern.
Deutschland ist bereits heute eines der Länder mit dem höchsten Durchschnittsalter in Europa – Tendenz steigend. Etwa 5 Millionen Menschen sind hierzulande pflegebedürftig (Stand: 2023), ein Großteil davon wird zuhause von Angehörigen betreut. Die Pflege ist ein intensiver Prozess, der viel Zeit, Kraft und Organisation verlangt. Zusätzlich entstehen dabei regelmäßig erhebliche Kosten – sei es für Pflegedienste, Pflegehilfsmittel, Umbauten in der Wohnung oder Unterbringung im Pflegeheim.
Ziel dieses Artikels ist es, diese Pflegekosten steuerlich greifbar zu machen und eine klare, verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung zu bieten, wie sie richtig in der Einkommensteuererklärung vermerkt werden können – egal ob bei häuslicher oder institutioneller Pflege.
Gesellschaftlicher und gesetzlicher Hintergrund der Pflegekosten
Die alternde Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf Angehörige
Die demografische Entwicklung führt in Deutschland dazu, dass der Pflegebedarf kontinuierlich wächst. Die Verantwortung für diese Pflege übernehmen häufig Familienangehörige – meist Töchter, Schwiegertöchter oder Ehepartner. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf den Alltag, sondern auch auf Erwerbstätigkeit, soziale Teilhabe und finanzielle Stabilität.
„Viele Angehörige leisten täglich Pflegestunden, die mit einem Vollzeitjob vergleichbar sind, ohne dafür entlohnt zu werden“, erklärt Dr. Martina Krüger, Pflegewissenschaftlerin aus Köln. „Eine steuerliche Entlastung ist zwar keine Entschädigung, aber ein wichtiger Schritt zur Anerkennung dieser Arbeit.“
Rechtlicher Rahmen – Pflegegrade und Leistungen
Um Pflegekosten steuerlich absetzen zu können, ist es wichtig, den gesetzlichen Rahmen zu kennen. Die Pflegeversicherung unterscheidet zwischen fünf Pflegegraden (1 bis 5). Je nach Einstufung stehen dem Pflegebedürftigen und seinen Angehörigen unterschiedliche Sachleistungen und Geldleistungen zu:
- Pflegegeld: Direkte Auszahlung an Pflegebedürftige bei häuslicher Pflege durch Angehörige oder Ehrenamtliche
- Pflegesachleistungen: Leistungen durch ambulante Pflegedienste
- Kombinationsleistungen: Kombination aus Pflegegeld und Pflegesachleistung
- Verhinderungspflege: Übernahme der Kosten für eine Ersatzpflegeperson bei temporärer Verhinderung der Hauptpflegeperson
- Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen: Zuschüsse für Umbauten in der Wohnung (z. B. Einbau eines Treppenlifts)
Nicht alle Ausgaben werden automatisch von der Pflegekasse übernommen. Oft entstehen Zusatzkosten, die Betroffene oder ihre Angehörigen selbst tragen – und diese können unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich geltend gemacht werden.
Welche Pflegekosten können steuerlich abgesetzt werden?
Grundsätzlich unterscheidet das deutsche Steuerrecht zwischen mehreren Kategorien, unter denen Pflegekosten angesetzt werden können:
1. Außergewöhnliche Belastungen (§ 33 EStG)
Die häufigste Möglichkeit, Pflegekosten abzusetzen, ist über die sogenannten außergewöhnlichen Belastungen. Darunter versteht man Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen zwangsläufig entstehen und über das hinausgehen, was anderen unter gleichen Umständen zumutbar wäre.
Folgende Kosten können hierunter fallen:
- Selbst getragene Kosten für ambulante oder stationäre Pflege
- Eigenanteile bei Pflegeheimkosten
- Honorare für Pflegedienste
- Kosten für Pflegehilfsmittel (z. B. Pflegebett, Rollstuhl), sofern nicht von der Kasse übernommen
- Ausgaben für wohnraumverbessernde Maßnahmen, falls nicht vollständig bezuschusst
Zu beachten ist hierbei, dass das Finanzamt nur den Anteil akzeptiert, der über die zumutbare Eigenbelastung hinausgeht. Diese hängt vom Einkommen, Familienstand und der Anzahl unterhaltspflichtiger Kinder ab.
2. Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen (§ 35a EStG)
Findet die Pflege zuhause statt und werden hier beispielsweise Pflegedienste oder Haushaltshilfen privat beschäftigt, kommt zusätzlich die Steuerermäßigung nach § 35a EStG in Betracht. Dabei können 20 % der Aufwendungen (bis maximal 4.000 € jährlich) direkt von der Steuerlast abgezogen werden.
Beispielhafte Leistungen:
- Haushaltsnahe Hilfe durch Pflegepersonal (Putzen, Einkaufen, Kochen)
- Pflege- und Betreuungstätigkeiten im häuslichen Umfeld
- Abrechnung über Rechnung mit Überweisung – Barzahlungen werden nicht anerkannt
Beispiel: Frau Neumann beschäftigt eine Pflegekraft, die monatlich 800 € erhält. Die Gesamtausgaben von 9.600 € im Jahr berechtigen zum Steuerabzug von maximal 4.000 €.
3. Außergewöhnliche Belastungen besonderer Art (§ 33b EStG)
Ist der Pflegebedürftige als „hilflos“ im Sinne des Gesetzes eingestuft (z. B. Pflegegrad 4 oder 5), kann ein gezielter Pauschbetrag geltend gemacht werden. Dieser beträgt pauschal 3.300 € pro Jahr (Stand 2023). Vorteil: Es müssen keine Einzelbelege eingereicht werden.
Voraussetzung ist der entsprechende Eintrag im Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen „H“ oder Pflegegrad 4 oder 5 mit Nachweis der Hilflosigkeit).
4. Pflegekosten im Pflegeheim – Sonderfall
Oft ist die Unterbringung in einem Pflegeheim unausweichlich. Dabei entstehen Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Pflege und Investitionen. Nicht alle Bestandteile sind steuerlich absetzbar:
- Abzugsfähig: Pflegekosten und medizinisch notwendige Betreuung (z. B. Grundpflege)
- Nicht abzugsfähig: sogenannte „Hotelkosten“ wie Miete, Verpflegung oder Freizeitangebote
Tipp: Bitten Sie das Pflegeheim um eine detaillierte Aufschlüsselung der Monatskosten. Nur so kann beim Finanzamt nachvollziehbar belegt werden, welcher Anteil auf Pflegeleistungen entfällt.
Pflegekosten in der Praxis: Schritt für Schritt zur Eintragung in der Steuererklärung
Die richtige Eintragung in die Steuererklärung erfolgt über die sogenannten „Anlagen“ zur Einkommensteuererklärung:
1. Anlage Außergewöhnliche Belastungen (Anlage N oder Anlage Kind)
- Eintragung der Gesamtpflegekosten
- Abzug von Erstattungen durch Pflegekasse oder private Versicherungen (Nettoaufwendungen)
- Berücksichtigung der zumutbaren Belastung automatisch durch das Finanzamt
2. Anlage Haushaltsnahe Dienstleistungen
- Eintragung unter Zeile 5–10 für haushaltsnahe Dienstleistungen
- Rechnungen und Überweisungsbelege aufbewahren – aber nur bei Nachfrage einreichen
3. Anlage Außergewöhnliche Belastungen – Pauschbetrag
- Nichteintragung einzelner Ausgaben bei Nutzung des Pauschbetrags
- Pflegegrad oder Hilflosigkeit als Beleg beifügen (z. B. Kopie Pflegebescheid)
Praktische Tipps für Angehörige und Pflegende
Dokumentation ist das A und O
Nur wer Belege, Rechnungen und Pflegezeitnachweise geordnet aufbewahrt, kann im Streitfall gegenüber dem Finanzamt überzeugen. Führen Sie idealerweise:
- Pflegeprotokolle oder Einsatzpläne
- Rechnungen für Hilfsmittel, Pflegeleistungen und Umbauten
- Nachweise über Zahlungen (Kontoauszüge, Überweisungen)
Beträge direkt vom Steuerbetrag abziehen – nicht nur vom Einkommen
Viele Pflegeleistungen gelten als steuerermäßigende Ausgaben – sie reduzieren direkt die Steuerlast, nicht das zu versteuernde Einkommen. Das spürt man unmittelbar im Geldbeutel.
Professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen
Es kann hilfreich sein, sich Unterstützung durch:
- Einen Lohnsteuerhilfeverein
- Ein Steuerberatungsbüro
- Kommunale Pflegeberatung
zu holen. Besonders bei komplexen Fällen, etwa mehreren Betreuungsverhältnissen oder bei grenzüberschreitender Pflege, entsteht schnell Unsicherheit.
Emotionale Komponente der Pflege – eine menschliche Perspektive
Pflege bedeutet weit mehr als finanzielle Organisation – sie bedeutet, für einen Menschen da zu sein, wenn dieser sich selbst nicht mehr ohne Hilfe versorgen kann.
„In der Pflege zählt nicht nur Effizienz, sondern vor allem Beziehung. Steuern betreffen nur Zahlen, aber sie spiegeln auch Fürsorge und Verantwortung wider“, sagt Dr. Andreas Meuser, Gerontologe und Berater für pflegende Angehörige in Berlin.
Die steuerliche Entlastung kann daher eine indirekte Anerkennung dieser Leistung sein. Sie gibt pflegenden Angehörigen nicht nur finanziellen Spielraum, sondern auch das Gefühl, gesellschaftlich nicht vergessen worden zu sein.
Fazit – Steuerliche Entlastung als Teil eines tragfähigen Pflegekonzepts
Pflege ist eine komplexe Aufgabe – emotional, praktisch und finanziell. Die Möglichkeit, Pflegekosten steuerlich geltend zu machen, ist dabei ein essenzielles Werkzeug, um gerade Angehörige zu unterstützen, die ohnehin viel leisten. Die Kombination aus Pauschbeträgen, außergewöhnlichen Belastungen und haushaltsnahen Dienstleistungen eröffnet verschiedene Wege, um entstehende Kosten zu kompensieren.
Doch nicht jeder Fall ist gleich. Wer sich mit der Thematik auseinandersetzt, sollte individuell prüfen lassen, welcher Weg steuerlich am günstigsten ist. Der Kontakt zu Pflegeberatungseinrichtungen, ein Gespräch mit dem Steuerberater oder ein Blick auf die offiziellen Informationsseiten des Bundesministeriums für Finanzen können dabei wertvolle Hinweise liefern.
Das Wichtigste bleibt: Die Pflege eines Menschen ist ein Ausdruck humanitärer Verantwortung – und verdient jede Form der Unterstützung, die das System zu bieten hat.